Die Müdigkeit und Kälte der vergangenen Nacht sitzt mir in den Knochen. Ich habe sie auf dem harten Boden einer Schule in Paucartambo verbracht, unserem Zufluchtsort. Einen anderen Schlafplatz konnten wir gestern Abend nicht mehr auftreiben. Genauer gesagt haben wir in einem Abstellraum geschlafen, dessen Tische, Schränke und Computer aus dem letzten Jahrhundert alles blockierten. So mussten wir uns erst einmal eine Fläche freischaufeln, um danach unsere Schlafsäcke auszurollen. Gestern Abend bei Ankunft in Paucartambo war meine Stimmung im Keller. Meine peruanischen Kumpaninnen Steff und Eva wollten sich um einen Schlafplatz kümmern und scheiterten kläglich.
Der Maskenkarneval in Paucartambo
Paucartambo ist ein koloniales Andendorf auf 2.900 Metern Höhe, in dem 362 Tage im Jahr der Hund – oder vielleicht sollte man sagen – das Lama begraben liegt. Mit seinen schneeweißen Wänden und den azurblauen Türen sowie Balkonen wirkt Paucartambo wie ein nobles Geisterdorf, dessen Bewohner in die größeren Städte Cusco, Arequipa und Lima geflohen sind. Doch einmal im Jahr, vom 15. bis zum 17. Juli ist in Paucartambo die Hölle los, wenn der Maskenkarneval auf dem Festprogramm steht. Busse über Busse rollen an. Schaulustige aus dem ganzen Land zieht es nach Paucartambo, kein Wunder, dass es zu einem extremen Engpass an Schlafplätzen kommt. Die wenigen Unterkünfte, die es gibt, wissen um ihr Monopol und ziehen ihre Preise bis zur Lächerlichkeit hoch. Private Schlafquartiere fordern für ihre Dürftigkeit ebenfalls Preise, die einen nur den Kopf schütteln lassen. Doch hier kommt’s: Auf dem Schulboden haben wir doch tatsächlich gratis geschlafen, denn in letzter Minute konnte Steff eine Freundin ihrer Tante aus dem Boden stampfen. Hallelujah – oder wie das eben so ist in Peru.

Mit dem Bus von Cusco nach Paucartambo …

Ein Kolonialdorf mitten in den Anden
Spätestens mit der mitreißenden Musik und den ersten Sonnenstrahlen ist die Müdigkeit im Nu über alle Berge verschwunden. Was sich in der vergangenen Nacht auf den Straßen Paucartambos abgespielt hat, erschließt sich mir erst beim Verlassen der Schule. Prompt steigt mir ein Geruch von Bier, Urin und seltsamer Weise frittiertem Schweinefleisch in die Nase. Der Blick auf’s desaströse Schlachtfeld vom Saufgelage löst bei mir akute Fluchtgedanken aus. Jetzt wird klar, warum Paucartambo auch als peruanisches Oktoberfest betitelt wird. Aber muss man sich deswegen gleich die Schädeldecke wegsaufen? Unverständnis macht sich bei mir breit. Aus der Ferne höre ich ein melodisches Orchester und fröhlichen Gesang. In der Hoffnung, das mystische Paucartambo abseits der Schnapsleichen kennenzulernen, lasse ich mich treiben … Allí voy!

Auf dem Paucartambo wird viel getrunken …

… und viel gegessen!
Paucartambo gleicht einem skurrilen Theaterstück.
Über zwölf maskierte Tänzergruppen beschreiben ein Wirrwarr an historischen Ereignissen, Legenden und Erzählungen aus der Folklore Perus. Und wie bei allen Festen symbolisiert auch das Paucartambo den jahrhundertealten Kampf zwischen Christentum und andiner Unabhängigkeit. Höhepunkt der Festlichkeit ist die Huldigung der Virgen del Carmen am 16. Juli. Sie repräsentiert den christlichen Glauben, doch die Indigenen sehen in ihr lieber ihre Muttererde, Pachamama, weswegen sie auch Mamacha Carmen genannt wird. Unter Weihrauch und gefolgt von einer Blaskapelle schwebt die Heilige über die Menge hinweg, um eine Runde durch Paucartambo zu drehen. Wie aus dem Nichts erscheinen bunt gekleidete Teufel mit struppigen blonden Haaren, sie wandeln über den Dächern, sie lehnen sich von den Balkonen. Mit ihren langen Fingernägeln versuchen die Saq‘ras, die Jungfrau Carmen zu verführen. Ich möchte niemals solch einem Teufel bei Dunkelheit begegnen, denke ich mir. Die Saq‘ras sind eine Mischung aus andinem und europäischem Teufel. Diese dubiosen Figuren machen Paucartambo zu einer surrealen Show, an deren Wirklichkeit man Jahre später doch tatsächlich zweifelt.

Die Virgen del Carmen wird in einer feierlichen Prozession durch Paucartambo getragen.

Die Saq’ras steigen auf die Balkone und Dächer, um die Heilige Jungfrau zu verführen …

Blondes, struppiges Haar und lange Fingernägel
Alles wirkt ein wenig unkoordiniert, aber das ist egal, solange es in allen Straßen etwas Kurioses zu bestaunen gibt. Auf dem Hauptplatz mit seinen exotischen Palmen ziehen gerade die Qhapaq Qollas mit beladenen Lamas vorbei. Der Legende nach stammen sie aus der Hochebene der Anden und sind das Ergebnis einer Vereinigung von Mensch und Lama. Sie tragen weiße Wollmasken, ihr quadratischer, mit bunten Pailletten bestickter Hut hängt auf dem Rücken, darunter ausgestopfte Vicuñas – ob sie echt sind, weiß ich nicht. Ihre Glocken machen bei jedem Schritt Lärm. Die Qhapaq Qollas haben ihren großen Auftritt, wenn sie auf ein fünf Meter hohes Holzgestell klettern, um von dort oben Plastikgeschirr, Obst und Spielzeug in die schaulustige Menge zu werfen. Ein Ereignis jagt das Nächste.

Alle Tänzergruppen tragen Masken
Nun kommt uns ein Trupp mit schwarzen Masken entgegen. Sie werden die Qhapaq Negros genannt und repräsentieren die afrikanischen Sklaven, die zu Kolonialzeiten auf Plantagen südlich von Lima arbeiteten. Mit ihnen mache ich ein Foto. Die farbenfrohen Tänze, die ekstatischen Trommelwirbel und schrillen Pfiffe, der in Perfektion blau strahlende Himmel und die Ausgelassenheit dieses imaginären Festes wirken auf mich wie ein Rausch. Ich lasse mich fröhlich treiben, knipse hier und da ein Foto, doch auf einmal packt mich jemand von hinten und wirbelt mich durch die Luft. Das ist wie ein Traum, nichts ist unter Kontrolle, mein Herz fährt Achterbahn.

… und plötzlich wird man durch die Luft gewirbelt
Als ich sehr wackelig, aber zumindest wieder mit zwei Beinen auf dem Boden stehe, schaue ich einem Maqta Tänzer in seine Schlitzaugen, seine Maske streckt mir die Zunge raus. Ich bin verwirrt. Er huscht weiter, springt in die Lüfte und lässt seine Peitsche auf dem Boden aufschnellen. “Eieieiiieiiiii”, jubelt er. Die spitzbübigen Maqta sind die Aufpasser vom Paucartambo, sie sorgen für Recht und Ordnung, zügeln den hemmungslosen Bierfluss bei religiösen Zeremonien und stiften Angst und Schrecken bei den Touristen – zumindest hätten sie mein Herz fast zum Stillstand gebracht. Ich kann die Absurdität des Moments nicht begreifen. Ich bin mitten drin im wilden Westen der Anden – auf einem Fest außer Rand und Band.







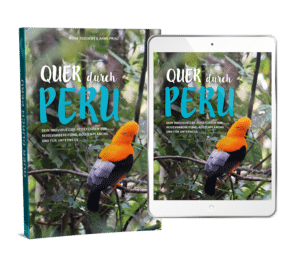




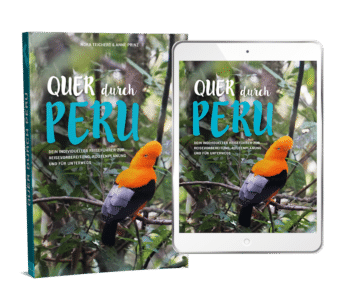
0 Kommentare